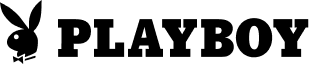50 Jahre Flucht: Leslie Mandoki über seine Ankunft in Deutschland, den Drang nach Freiheit und sein Jubiläums-Konzert in Budapest


Herr Mandoki, erinnern Sie sich an den Moment, als Sie erstmals den Boden im Westen betraten?
Das gab es quasi zweimal. Einmal in Österreich, als wir aus dem Tunnel kamen. Wir wussten ja, dass der Tunnel in Österreich endet. Ich umarmte ein Transformatorenhäuschen, auf dem „Lebensgefahr“ stand. Aber ich wusste ja nicht, was das heißt. Ich wusste, jetzt bin ich frei. Ich war so gerührt. Es war eine völlig schräge Bestätigung, dass uns die Flucht gelungen ist. Der Moment in Deutschland war aber noch stärker. Und eigentlich gab es sogar drei „erste Male“…
Nämlich?
Österreich war damals neutral und hatte damals das Genfer Flüchtlingsabkommen nicht unterschrieben. Künstler wie wir hätten damals in irgendeinem Lager verschmoren müssen. Der „Brain Drain“ aus Osteuropa war riesig. Es gab da jede Menge gut ausgebildeter Facharbeiter, Ärzte, Ingenieure. Die sammelten die Kanadier, Amerikaner, Schweden, Norweger und so weiter dankbar ein. Das waren Leute, die waren 30, vielleicht 35. Aber mit Künstlern konnte man wenig anfangen, ein in Ungarn großer Rockstar ist dort im Auffanglager verkommen. Das wussten wir, das hat uns geprägt. Deswegen wollten wir weiter nach Deutschland und dann über Skandinavien nach Amerika. Es war die Zeit der RAF, aber wir haben es durch Wälder und so weiter durchgeschafft. Bis in die ungarische Mission in München, eine Traumhafte Villa im Stadtteil Bogenhausen.
Wie war es dort?
Der Chef dort war ein katholischer Pfarrer – und mein Patenonkel. Er kam mit Priestergewand heraus und wollte uns nicht reinlassen, weil wir lange Haare und Stirnbänder trugen. Die anderen hatten auch noch Vollbärte. Er meinte, das geht nicht. Denn die ganzen Professoren brachten ihre Töchter hier zum Volkstanz-Unterricht und zum ungarischen Geschichtsunterricht. Und wenn die solche Hippies hier sehen, dann kommt die ganze Einrichtung in Verruf. Das war ja hier das ganze Münchener ungarische Großbürgertum. Für uns ging es dann weiter, wir wollten bis nach Schweden kommen und von Stockholm nach Los Angeles, das war der Plan. Doch dann war in Dänemark Schluss, die Dänen haben uns dann geschnappt.
Wie ging es da für Sie weiter?
Die Grenzbeamten waren sehr freundlich, wir durften in den Zellen übernachten, waren aber nicht eingesperrt. Wir tranken Bier und einer der Beamten fragte mich aus. Denn er hatte einen Pauschalurlaub an den Plattensee gebucht und wollte wissen, wie es dort ist. Am nächsten Morgen kam für den Transport über die Grenze nach Deutschland ein VW-Bus der Polizei. Alles war sehr nett und herzlich. Eigentlich hätten wir zurück nach Österreich gemusst…
Aber?
Der verantwortliche Beamte meinte: „Wenn ihr da im Lager seid, kommt ihr ewig nicht weg. Ich kümmere mich.“ Erstmal wurden wir in Flensburg untergebracht und befragt, was wir denn beruflich so machen. Wir haben erklärt, dass wir zwei Musik machen und einer von uns Trickfilme. Wir verbrachten zwei, drei Nächte in Deutschland. Sie haben uns alle Papiere besorgt und organisiert, dass wir in ein Lager nach Zirndorf bei Nürnberg kamen. Es war ein Land zum Verlieben. Und Deutschland war darin verliebt, dass Sachen gelingen.
Wie haben Sie den Westen wahrgenommen?
Wir sind aus dieser osteuropäischen Dysfunktionalität geflüchtet. Das mag mit Blick aus dem Westen charmant und lustig ausgesehen haben. Aber es war eine Diktatur mit Zensur und Schießbefehl. Von drinnen war das aber nicht lustig, auch wenn es dort vielleicht lockerer zuging in der DDR. Aber auch Ungarn war militant und von Russland geprägt, die Medien waren zensiert, die Journalisten haben mit Schere im Kopf geschrieben. Und hier bin ich angekommen und habe Deutsch gelernt mit der „FAZ“ und der „SZ“, die nur bei zwei Themen einer Meinung waren: Beim Wetterbericht und beim TV-Programm. Diesen Pluralismus fand ich traumhaft! Diese Friedfertigkeit, Meinungsvielfalt und gleichzeitig der Anspruch, Stärke zu zeigen – das hat mich beeindruckt! Mir war damals bewusst, dass die Mauer fallen kann. Und sie tat es irgendwann auch.
Gab es Sachen, die Sie verwundert haben?
Ja, aber sehr positiv. Dieses absolute laissez-faire, boheme München. Das hat mich überrascht, da Bayern und auch München so ein konservatives Image hatten. Aber hier traf ich Freddie Mercury und Queen. Hier waren die Stones, Deep Purple und Donna Summer, um ihre Alben aufzunehmen.
Und trotzdem war es das Bayern von Franz-Josef Strauß …
Ich habe ihn sogar einmal kennengelernt. Bei einem Redaktionsbesuch. Ich wurde ihm vorgestellt, als ungarischer Flüchtling, Musiker und so weiter. Er hat sich das alles erklären lassen und meinte, als er ging: „Den lass ich euch hier, der ist mehr Bayer als ich“, und in die erstaunten Blicke sagte Strauß „er ist geflüchtet und hat sein Leben riskiert, um Bayer zu werden. Ich habe das vom lieben Gott geschenkt bekommen!“ Das hat mich sehr beeindruckt.
Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen und über Ihre Flucht sprechen. Sie gingen damals zu Fuß durch den rund acht Kilometer langen Karawankentunnel. An was erinnern Sie sich?
Da waren Ratten, Fledermäuse, die einem ins Gesicht geflogen sind, Grundwasser, Dreck aus… ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten. Unsere russischen Turnschuhe wurden vom Eisenbahngestein zerrissen. Wir hatten Todesangst, erschossen zu werden. Oder dass diese – zum Glück schlecht abgerichteten – Suchhunde uns erwischen. Wir haben ihnen rohes Fleisch gegeben, bis ihnen davon schlecht wurde. Wir haben das aber alles nicht aus Abenteuersehnsucht gemacht, es war Sehnsucht nach Freiheit.
Wie lange haben Sie die Flucht vorbereitet?
Am 25. Juli fassten wir nachts den Beschluss auf der Kettenbrücke in Budapest. Das war nicht so einfach. Gabor kam aus einer Antikommunistischen Familie, wie ich. Aber Laszlo eben nicht. Es dauerte, bis wir das Vertrauen zueinander gefestigt hatten. Wir hätten ja fünf Jahre in den Knast gemusst, hätte man uns bei unserer Flucht erwischt. Es dauerte einen knappen Monat, bis zum 21. August, bis wir alle Vorbereitungen getroffen hatten.
Sie hatten damals allesamt große Pläne, als Sie in Deutschland ankamen…
Ich gab bei der Asylaufnahme an, dass ich mit Jack Bruce von „Cream“, Ian Anderson von „Jethro Tull“ und Al Di Meola musizieren will. In unserer Wahrnehmung war Deutschland ein Land der Möglichkeiten. Zweieinhalb Wochen nach der Antragstellung auf Asyl durfte ich über die Vermittlung durch den Künstlerdienst im schwäbischen Landestheater Schlagzeug spielten. 85 Tage nach Antragstellung hatte ich mein Asyl. Ich bin heute froh, dass ich keine „Willkommenskultur“ erfahren habe, sondern ich bin einfach willkommen gewesen.
Was meinen Sie damit?
Ich hatte Rechtssicherheit und eine Arbeitsmöglichkeit. So habe ich Deutschland wahrgenommen, ein Paradies. Heute sieht das leider anders aus. Wer hier herkommt darf Jahre lang nicht arbeiten, hat keinen sicheren Status und wird anscheinend nicht gebraucht, aber wird alimentiert. Das ist eine Katastrophe! Wir machen in der Hinsicht alles falsch.
Was wäre Ihrer Meinung nach die bessere Lösung?
Zwei Dinge: Die Einsicht, das Integration eine Bringschuld der Immigranten ist. Was soll das heißen, wenn jemand sagt, er hat keinen Bock auf einen Sprachkurs? (lacht) In welcher Welt leben wir da? Wir brauchen keine Angebote zu machen, wir dürfen als Land eine Erwartungshaltung haben. Wir müssen vermitteln, dass unsere Werte unantastbar sind. Toleranz ist für mich der wichtigste Wert im Nachkriegsdeutschland. Aber Toleranz darf nicht so weit gedehnt werden, dass auch Intoleranz toleriert wird. Wir dulden keinen Antisemitismus, keine Homophobie, Mann und Frau sind gleichgestellt, Respekt gegenüber Nicht-Binärer und, und, und… Die deutsche Leitkultur ist Toleranz und Respekt anderen gegenüber. Das muss ohne Wenn und Aber von Menschen, die ins Land kommen akzeptiert werden. Da darf es kein Zurück geben. Als ich nach Deutschland kam, durften Frauen nicht ohne Zustimmung ihres Mannes arbeiten, Homosexualität war strafbar. Wir haben also eine fette Strecke hinter uns. Aber wir haben auch einen langen Weg vor uns.
Was ist der zweite Punkt?
Ich sprach damals kein Deutsch, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, konnten oft kein Englisch. Das waren erst einmal im Theater alles ältere Herrschaften, mit denen ich musizierte. Genau das hatte eine so große integrative Kraft. Sie waren gezwungen, mich zu integrieren und ich war gezwungen, mich zu integrieren. Da musste mich aber keiner an die Hand nehmen. Ich wurde nicht gefördert, mir wurde einfach gezeigt, dass ich gebraucht werde und Rechtssicherheit habe. Ich durfte ein wertvoller Teil der Gesellschaft werden. Ich wurde nicht in irgendein Wohnheim gesteckt.
Warum tun wir uns heute so schwer damit, wenn es damals so gut gelang?
Ich kann es schwer sagen. Wenn ich auf die Bühne schaue, wenn wir mit den „Soulmates“ spielen, sind da alle Generationen und Hautfarben vertreten. Wir leben die Ideale. Ich bin nicht der einzige Flüchtling in unserer Truppe. Aber warum wir uns als Land so schwer tun, darüber müssen wir ideologiefrei und offen diskutieren.
Sie sind zusammen mit Laszlo Bencker und Gábor Csupó geflüchtet. Ersterer wurde ein musikalischer Weggefährte von Ihnen, der andere ging weiter in die USA und feierte mit seinem Animationsstudio Erfolge. Unter anderem war er für die ersten drei Staffeln von „Die Simpsons“ verantwortlich. Viele erfolgreiche Menschen, sind irgendwann aus ihren Heimatländern geflüchtet. Woher kommt es, dass Geflüchtete oft zu Höchstleistungen fähig sind?
Ich glaube, man ist gewissermaßen gestählt durch diese Erlebnisse. Der Durchdringungsgrad wird geschult. „You never take no for a no“. Eine Niederlage ist nur eine Station zum Erfolg, eine Ablehnung nur ein weiterer Ansporn, es besser zu machen.
Sie Sprechen oft von der Freiheit. Wie hat sich Ihr Verständnis von Freiheit in den Jahren seit ihrer Ankunft in Deutschland verändert?
Gar nicht. Das ist vielleicht die Krux. (lacht) Freiheit ist Freiheit. Das hat nichts mit Politik und schon gar nicht Parteipolitik zu tun. Das ist eine mentale Angelegenheit.
Fühlen Sie sich immer noch so frei, wie bei ihrer Ankunft oder hat sich die Wahrnehmung geändert?
Ja, da hat sich mein Gefühl verändert. Es haben sich Dinge geändert. Mit 18 wurde ich bespitzelt, ich wurde verraten. Wir haben aber damals, wenn wir angenommen haben, dass keine Spitzel anwesend sind, komplett frei über Hegel, Nietzsche oder Kant diskutieren können. Heute ist es, durch das veränderte gesellschaftliche Klima, angetrieben durch die starke Wirkung der sozialen Medien, schwieriger, ein echtes Streitgespräch zu führen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer und viele Menschen bewegen sich nur noch mit Gleichgesinnten in ihren Echokammern und Filterblasen. Aber ich bin der Überzeugung, die gegenteilige Meinung ist genauso wertvoll wie meine. Lasst uns diskutieren! Das haben wir verlernt und ich glaube, das hat uns auch in dieses Labyrinth der Krisen geführt. Jemand, der eine andere Meinung hat, ist deswegen nicht automatisch mein Feind, sondern erstmal nur jemand mit einer anderen Meinung. Wir können voneinander und übereinander lernen. Erkenntnisgewinn ist das Geheimnis dieser Dialektik.

✓ Alles, was Männer lieben
✓ Meinungen, Tipps und schöne Frauen
✓ Jeden Mittwoch in Ihrem Postfach
Wo ist diese liberale Ansicht zuletzt auf Unverständnis getroffen?
Ein Beispiel: Wir beide sind uns sicher einig, dass Putin ein blutrünstiger Mensch ist, für den ein Menschenleben nichts zählt. Da werden die meisten beipflichten. Ich habe 1956 als Dreijähriger erlebt hat, wie in unserer Wohnung in Budapest drei ungarische Studenten gestorben sind, die von Russen erschossen wurden. Russophobie ist mir daher quasi in die Wiege gelegt, aber dennochmöchte ich sehr wohl Putin und sein Handeln verstehen können. Deswegen bin ich doch noch lange kein Freund Putins geschweige seiner Politik. Ich kenne die russische Kunst sehr gut, denn die Idee im russischen Kommunismus war, dass von Nordkorea bis Kuba nur Russisch gesprochen wird. Ergo, ich kenne Dostojewski und Puschkin und Strawinsky und Eisenstein – und das ist auch gut so, das ist großartige Kunst. Aber die Menschenverachtung ist auch in diesen Kunstwerken herauszulesen. Freies Denken und freie Meinungsäußerung ist wichtig. Wir müssen streiten. Wir müssen uns intellektuell und wertegebunden austauschen, das darf und muss vielleicht auch unbequem sein. Raus aus den Blasen, raus aus den Komfortzonen. Ich habe daher unfassbaren Respekt vor meiner Tochter, die im Hambacher Forst protestierte. Aber es müssten noch mehr Menschen offen diskutieren!
Sind wir zu bequem geworden?
Die Probleme sind sehr komplex geworden und ja, vielleicht ist es auch Bequemlichkeit. Der Sozialstaat ist eine grandiose Idee der Sozialdemokraten. Die Idee war, unabhängig von der Herkunft gleiche Chancen zu ermöglichen. Grandios! Aber arbeitsunwillige Menschen dauerhaft zu alimentieren war nicht die Idee. Das ist höchst unsozial denjenigen gegenüber, die zeitlebens in der Früh aufstehen und Arbeiten gehen. Es geht darum, jemandem aufzuhelfen, wenn er gestolpert ist.
Wie haben Sie Europa damals wahrgenommen und wie tun Sie es heute?
Ich mag den Gedanken, dass man sich als Franzose, Italiener, Ungar oder Deutscher, und gleichzeitig als Europäer fühlen kann. Der europäische Gedanke lebt davon, dass wir unterschiedlich sind. Ein Sizilianer hat ganz andere Themen und Sorgen als ein Nordschwede. Der Nordschwede wird sich keine Gedanken machen müssen, ob die Müllabfuhr kommt oder nicht, die kommt einfach. Und der Sizilianer muss sich keine Sorgen machen, dass der Fischereihafen einfriert. Unsere Kulturen sind unterschiedlich. Aber gerade diese Unterschiedlichkeit, diese Farbigkeit Europas und auch Deutschlands, ist eine Stärke – ohne die Farbe Braun! Das ist eine großartige Idee. Aber da muss man Platz lassen, für die unterschiedlichen historischen Erfahrungen. Es gibt viele kluge Ideen, aber vieles in der EU macht es auch schwierig. Und wir schicken ja nicht unbedingt unsere besten Leute nach Brüssel. Das sollte aber keinen Schatten auf die grandiose Idee des gemeinsamen Europas werfen.
Ihre Musik hat Sie um den ganzen Globus geführt. Was haben Sie bei Ihren Reisen gelernt?
Man lernt, über den Tellerand zu schauen und nicht im eigenen Saft zu schmoren. Man hat mit so vielen Leuten zu tun, Kameramännern, Kabelträger, Fahrer, Journalisten, Regisseure, Musiker … Man lernt, dass das, was man selbst gemacht und erlebt hat, nicht unbedingt das beste und einzig richtige ist, sondern bekommt einen differenzierten Blick auf die Welt. Man kommt nach Hause und dir wird klar, du lebst in einem Paradies. Aber die Welt ist größer als das!
Sie holen die Welt auch regelmäßig nach Tutzing in Ihr Studio. Diese Stars kommen nach Deutschland, nach Bayern. Wie sehen Sie das Land?
Ich habe früher viel in Amerika gearbeitet, aber als die Kinder kamen, hatte ich Heimweh. Ich wollte nicht getrennt von Ihnen sein. Deswegen habe ich das Studio in Tutzing eingerichtet. Alle Musiklabels meinten, das geht nicht. Aber doch, es ging. Phil Collins war hier, Lionel Ritchie und Chaka Khan... Ich glaube, ich konnte mit einigen verstaubten Deutschland-Bildern aufräumen. Sie lieben München, die „Weltstadt mit Herz“, das Oktoberfest, aber genauso die Verrücktheit von Berlin und Hamburg mit seiner Beatles-Historie. Aber genauso bekomme ich Fragen zur AfD…
Sie sind sehr gut vernetzt, ob es Ihre Verbundenheit zu Gorbatschow war oder ihre Beziehung zu Staatsoberhäuptern wie Angela Merkel und Victor Orban. Wie ist es Ihnen gelungen, diese Verbindungen aufzubauen?
Ich bin ein unangenehmer Freidenker, ich passe in keine Schublade. Vielleicht übt das einen gewissen Reiz aus. Bei meinem letzten Jubiläum hat Markus Söder eine Rede gehalten, Armin Laschet war da, genauso gratulierten Christian Lindner oder Claudia Roth. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich mit Till Brönner genauso musizieren kann wie Peter Maffay. Ich glaube, ich kann vielleicht gut Brücken bauen.
Mandoki Soulmates Open-Air-Concert: 50 Years In Freedom
Sehen Sie hier am 21. August um 19 Uhr die Mandoki Soulmates im Livestream
Was würden Sie einem Menschen raten, der nach Deutschland flüchtet?
Lerne die Deutschen lieben. Lerne Deutsch, grenze dich nicht aus, gehe auf die Menschen zu und bandel dich an. Die werden dich annehmen. Es ist ein tolles Land mit tiefsinniger Kultur.
50 Jahre nach Ihrer Flucht spielen Sie in Budapest auf dem Dreifaltigkeitsplatz. Welche Gefühle werden Sie dabei haben?
Viele Unterschiedliche Aspekte. Wir proben in dem Club, wo meine musikalische Karriere begann. Wir spielen vor 30.000, 40.000 Leuten. Wenn wir über Ungarn reden, kommt mir das Bild von Kohl, Brandt und Genscher in den Kopf. Die Ungarn und die Deutschen sind außerdem die einzigen beiden europäischen Länder, die in den letzten Tausend Jahren keinen Krieg gegeneinander geführt haben, hat mir Wolfgang Schäuble mal erzählt. Die vielleicht wichtigste Gemeinsamkeit ist 1989, das verbindet uns. Die Kommunisten haben hohe Strafen angedroht, DDR-Flüchtlinge aufzunehmen, doch die Ungarn haben es trotzdem getan. Diese Sehnsucht nach Freiheit hat den Eisernen Vorhang zerstört und es war nur noch eine Frage der Zeit, dass die Berliner Mauer fällt – ohne einen einzigen Schuss.
Worauf darf sich das Publikum freuen?
Viele filmische Elemente, Fotos von der Flucht, und vor allem großartige Musik. Es wird ein sehr emotionales Konzert. Nicht nur eine Show, sondern es wird viel handwerklich gute Musik geben mit all diesen Wahnsinnsmusikern um mich herum. Mit unserer Musik spielen wir den Soundtrack und die Hymnen für ein Utopia for Realists. Gemeinsam versuchen wir den Kompass wiederzufinden und das Ende des Tunnels hell zu erleuchten, raus aus dem Labyrinth der Krisen für eine bessere Welt. Für mehr Menschlichkeit, für generationengerechte Zukunft, denn Freiheit ist kein Erbe und keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Mission, die wir jeden einzelnen Tag verteidigen müssen.