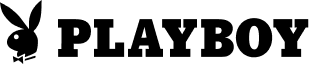Zur Waffe greifen: Notwendigkeit oder Rückschritt?


Playboy-Chef Florian Boitin findet: Für Freiheit lohnt es sich zu kämpfen
Hugh Hefner antwortete mal auf die Frage, vor welchen Dingen sich die US-Amerikaner in den 50er-Jahren, als er den Playboy gründete, am meisten gefürchtet hätten, mit „dass nachts der Russe einmarschiert und jemand vergisst, beim Sex das Licht auszumachen“. 70 Jahre später hat Amerika die weltweit größte Porno-Industrie, und die einstige Angst vor einer russischen Invasion ist der Furcht gewichen, vom Rest der Welt wirtschaftlich abgezockt zu werden. Lieber Zollkrieg mit allen als Zoff mit einem: Putin.
Anders die Situation hierzulande. Spätestens seit dem Überfall des Kreml-Tyrannen auf die Ukraine vor drei Jahren beherrscht die Angst vor einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland wieder Politik und Schlagzeilen. Von Kriegstüchtigkeit ist nun wieder die Rede.
Mit 18 Jahren habe ich den Kriegsdienst verweigert. Ende der 80er-Jahre wehte der Wind of Change über den Globus, den Menschen stand der Sinn nach Ab-, nicht nach Aufrüstung. Und unsere Freiheit musste weder am Hindukusch noch sonst wo verteidigt werden. Auf wen und warum sollte ich, der lieber „Give Peace A Chance“ auf der Gitarre klampfte, als Rambo im Kino bei seinem blutigen Rachefeldzug gegen die Sowjet-Armee zuzujubeln, also mit einer Waffe zielen wollen?
Unsere freiheitliche Ordnung, unsere Demokratie, ist inzwischen von vielen Seiten bedroht. Von innen wie von außen. Meine Erfahrungen mit Schusswaffen beschränken sich allerdings auf das Anlegen eines Luftgewehrs auf dem Rummelplatz. Ob ich im Ernstfall also – mit einer Waffe in der Hand – Putin und seinen Berufskillern wirklich etwas entgegensetzen kann, ist deshalb mehr als zweifelhaft. Andererseits: Nur wer ahnt, was er zu verlieren hat, weiß auch, wofür es sich zu kämpfen lohnt.
Playboy-Autor Markus Götting möchte das Kämpfen lieber Profis überlassen:
Manchmal ist Mangel ein strategischer Segen. Wir haben nichts, was imperiale Irre wie Donald Trump oder Wladimir Putin interessieren könnte. Kein Uran und keine Seltenen Erden, nicht mal stabiles Internet in Fernzügen. Anders als Trumps Sehnsuchtsorte Kanada und Grönland sind wir so rohstoffarm, wettergrau und langweilig wie unsere Reihenhaussiedlungen. Wer sollte uns überfallen oder annektieren wollen? Wirtschaftlich Weltmacht, geopolitisch Niemandsland – das war jahrzehntelang unser Sicherheitskonzept ganz ohne Militärhaushalt. Plötzlich aber reden alle von Wehrhaftigkeit, was in einer postheroischen Welt etwas aus der Zeit gefallen wirkt.
Natürlich finde ich Freiheit und Demokratie klasse, im Zweifel gehe ich auch zur Verteidigung von Bürokratie auf die Barrikaden. Aber mit der Knarre? Nö. Als Kriegs- und Krisenreporter habe ich viel über das Leben gelernt. Und noch mehr über das Sterben. Genau deshalb möchte ich das Kämpfen lieber Profis überlassen. Töten ist Handwerk, und ich habe aus guten Gründen nicht mal eine Bohrmaschine daheim. Wenn ich beim Oktoberfest das Luftgewehr anlege, evakuieren sie spätestens nach dem ersten Schuss den gesamten Stand. Dabei habe ich sogar gedient, wie man damals sagte. Ich lernte, ein Maschinengewehr zu zerlegen, hatte aber beim Zusammensetzen immer ein, zwei durchaus relevante Teile übrig. Wie beim Ikea-Schrank. Ich fiel bei der Grundausbildung durch und wurde in die Pressestelle der Luftwaffe abkommandiert. Vermutlich dachten sie, ich könnte den Feind mit Worten abschrecken. Heute ist die Bedrohung ja eher asymmetrisch: Fake News, Trolle, Verschwörungsgeschwurbel. Und wenn Putin jetzt Alice Weidel und Sahra Wagenknecht als ideologisches Vorkommando losschickt, fühle ich mich gerüstet. Jedenfalls rhetorisch.