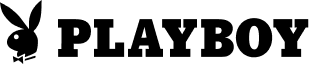Fatih Akin: „Mein Vater und ich konnten nicht zehn Sekunden über Politik reden“


Nur drei Jahre liegen dazwischen, aber unterschiedlicher könnten unsere Treffen kaum sein: Während wir uns zu Fatih Akins letztem Film „Rheingold“ gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen Rapper Xatar in einem dunklen Nachtclub auf der Hamburger Reeperbahn zum Gespräch zusammensetzten, wartet der Regisseur dieses Mal auf einer sonnenüberfluteten Hotelterrasse direkt neben dem Berliner Tiergarten. Der 52-Jährige ist barfuß, entspannt und sofort im Thema: einer Geschichte, die ihm nahegeht, obwohl es nicht seine ist.
Herr Akin, „Amrum“ ist die Kindheitsgeschichte Ihres Mentors Hark Bohm – eines weißen blonden Jungen, der als Sohn zweier strammer Nazis die letzten Kriegstage auf einer Nordseeinsel verbringt. Das hätte von Ihrer eigenen Biografie kaum weiter entfernt sein können, oder?
(Lacht) Vor allem, wenn man meinen letzten Film betrachtet, ne? (Für „Rheingold“ setzte sich Akin mit dem Werdegang des kurdischstämmigen Rappers Xatar alias Giwar Hajabi sowie mit seinen eigenen türkischen Wurzeln auseinander)
Dabei suchen Sie als Autorenfilmer ja immer nach den persönlichen Verbindungen zu Ihren Stoffen – wo haben Sie die bei „Amrum“ gefunden?
Die erste Querverbindung war für mich das Kino selbst: Es gibt Filme, die mir in meinem Leben immer wichtig waren und die ich sofort mit der Geschichte von „Amrum“ in Verbindung gebracht habe – „Stand By Me“, „Fahrraddiebe“ und natürlich „Nordsee ist Mordsee“ von Hark selbst. Was mich allerdings am meisten interessiert hat, war die Situation dieses Jungen, der weiß, dass sein Vater ein Nazi ist, und der mit einer Mutter aufwächst, die total rechts ist – aber er selbst ist es nicht. Wie bekommt man so etwas in einer Familie zusammen hin? Natürlich liebt er seine Mutter trotzdem, obwohl sie dieser unverzeihlichen Gang hinterherjubelt. Blut ist dicker als Tinte, Blut ist auch dicker als Cancel Culture.
In dieser Art von Dilemma haben Sie sich wiedergefunden?
Ich hatte dabei das Gefühl, dass ich das kenne, ja, denn ich habe so etwas in ähnlicher Form auch erlebt. Mein Vater und ich konnten nicht zehn Sekunden über Politik reden, ohne dass es megalaut wurde und wir uns einfach nur noch angebrüllt haben. Wir haben deshalb irgendwann beschlossen, das einfach sein zu lassen. Hark hat übrigens schon früh eine weitere Verbindung von mir zu diesem Jungen gesehen, den es von Hamburg aus in eine ganz eigene Inselwelt verschlägt. Er meinte zu mir: „Du bist der Richtige für den Film, denn du kennst das Gefühl, ein Außenseiter zu sein, aus deinen Sommerurlauben in der Türkei.“
Was genau meinte er damit?
Ich hatte ihm von den Ferien erzählt, die ich als Kind in dem Fischerdorf verbracht habe, aus dem meint Vater kommt. Bis Ende der 80er waren wir jedes Jahr dort. Ich habe Cousins im gleichen Alter, die mit mir fischen gegangen sind. Sie haben mir beigebracht, Netze zu häkeln und im Meer nach altem Eisen zu tauchen, das man dann auf dem Markt verkaufen konnte. Und sie hatten Hunde, mit denen sie nach Enten gejagt haben. Das alles habe ich mitgemacht, obwohl ich als Hamburger Großstadtjunge aus einem ganz anderen Zusammenhang kam, es war für mich ein unbeschreibliches Abenteuer.

„Blut ist dicker als Cancel Culture“, haben Sie gerade eben gesagt: Meinen Sie damit, dass es wichtig ist, Andersdenkende, die uns nahestehen, nicht abzuschreiben? Auch in Zeiten, in denen die Ansichten in unterschiedliche Richtungen immer radikaler werden?
Um mal ein Beispiel zu nennen: Ich habe ja eine Firma, meine Filmproduktion, und manchmal gibt es da juristische Streitigkeiten mit Leuten. Wenn da dann ein mega-aggressives Schreiben von einem Anwalt kommt, der eine Person vertritt, die ich gut kenne, versuche ich erst mal, mit der Person direkt zu kommunizieren, bevor ich genau so etwas zurückschicke. Ich rufe sie an und frage: „Was ist denn da los? Können wir das nicht klären?“ Manchmal funktioniert das und manchmal nicht, aber die Devise lautet, durchs Reden kommen die Leute zusammen. In der AfD gibt es ja nicht nur so richtig krasse Nazis, die Hitler nacheifern und sagen, den Holocaust hat es nicht gegeben – mit denen kann man nicht mehr reden, so etwas zu behaupten, ist ja auch strafbar. Es gibt aber bestimmt viele Leute, die einfach nur wütend sind und dem Rattenfänger folgen, die sich noch nicht radikalisiert haben. Und bei denen habe ich schon die Hoffnung, dass man durch Reden mit ihnen zusammenkommt. Denn dieses Tribale, dieses „Wir gegen die“, das hat uns auch da hingeführt, wo wir jetzt gelandet sind.
In den Produktionsnotizen zu „Amrum“ steht, dass der Film eine Reise in Ihre deutsche Seele ist. Was haben Sie auf diesem Trip entdeckt?
Man muss das ein bisschen im Kontext sehen. Ich hatte ja gerade zuvor „Rheingold“ gemacht – das war für mich eine Reise in die Seele meines „Kanakentums“. Durch die Auseinandersetzung mit diesem Deutschrap-Ding habe ich verstanden: Das ist mein Tribe, meine Herkunft. Und danach habe ich mich für „Amrum“ nun eben einer ganz anderen Aufgabe gestellt. Obwohl ich mir am Anfang natürlich gedacht habe: Was soll ich denn ausgerechnet über White People und über Nazis erzählen? Aber ich habe dann beschlossen: Okay, ich mache es wie ein Pro. Ich mache meine Hausaufgaben, ich recherchiere, ich versuche, Klischees zu vermeiden und so präzise wie möglich zu sein. Ich habe viel an die Familie meiner Frau gedacht. Meine Frau ist ja aus Schleswig-Holstein. Ihre Familie väterlicherseits sind alles Norddeutsche – bei denen habe ich mich reingearbeitet. Und dann kam dieser Ukraine-Krieg, und damit tauchten Fragen auf, die mich noch mal auf ganz andere Weise beschäftigt haben: Ist das hier mein Land? Würde ich das Land verteidigen, wenn Putin es angreift? Ich kam darauf, weil ich mich sehr für einen Roman interessiere, der sich genau damit auseinandersetzt: „Die Nulllinie“ von Szczepan Twardoch.
Zu welcher Antwort sind Sie gekommen?
Ich würde jetzt vielleicht nicht Friedrich Merz sein und Deutschland verteidigen wollen, aber ich würde die Bücherhallen verteidigen wollen, in denen ich war. Ich würde die Schulen verteidigen wollen, ich würde die Erzieherinnen verteidigen wollen – also bestimmte Menschen und Dinge. Gleichzeitig habe ich mir aber auch gedacht: Ey, es gibt ganz viele Leute in diesem Land, die dich gar nicht als Deutschen sehen, weil sie immer noch an Blutrechts-Shit glauben.
“Wenn ich davon ausgehe, dass Goethe recht hat, dann ist Deutschland mein Vaterland"
Das Prinzip, nach dem die Staatsangehörigkeit nur durch die Abstammung der Eltern und nicht durch den Geburtsort bestimmt wird, wurde in Deutschland ja tatsächlich auch erst Ende der 90er-Jahren geändert.
Das sagt sich so einfach: „Ich bin Deutscher.“ Aber bin ich es wirklich? Was bedeutet das? Ich bin dann auf ein Zitat von Goethe gestoßen: „Wo wir uns bilden, da ist unser Vaterland.“ Und ich dachte mir: Klar, meine Bildung habe ich aus Deutschland. Ich habe hier nicht nur Lesen und Schreiben und Rechnen gelernt, ich habe von hier vor allem meine filmische Ausbildung. Wenn ich davon ausgehe, dass Goethe recht hat, dann ist Deutschland mein Vaterland. Auch wenn ich vielleicht nicht das Trauma des Holocaust mit in meine DNA vererbt bekommen habe – wenn so etwas überhaupt geht.
Auch das ist ein Thema, mit dem Sie sich im Film beschäftigen. „Ob ich will oder nicht – wenn ich dich sehe, muss ich an deine Eltern denken“, bekommt die Hauptfigur von jemandem, der unter den Nazis sehr gelitten hat, gesagt.
Eine Zeit lang war dieser Satz draußen, weil ich die ganze Szene aus dramaturgischen Gründen rausgenommen hatte. Aber dann musste ich sie wieder reinnehmen, weil ich wusste: Wenn ich diesen Satz nicht habe, habe ich keinen Film. Es ist das essenziellste Zitat des Films, denn man sucht ja immer Bezüge zu heute, und dass wir dieses Nazi-Ding nie losgeworden sind, ist eben sehr aktuell. Dieser Satz hat zu unserer Staatsräson gegenüber Israel geführt. Wir sind irgendwie mitschuldig und wollen davon weg, deshalb haben wir diese außenpolitischen Entscheidungen getroffen – es hat mit unserer Schuld zu tun, für die auch die Kinder und Kindeskinder noch haften.

Was hat eigentlich Hark Bohm selbst zu Ihrem Film über seine Kindheit gesagt?
Er war gerührt und hat den Film als sehr gelungen empfunden, da fiel mir natürlich ein Stein vom Herzen. Wir haben beide geflennt, als ich ihm die erste Fassung gezeigt habe. Ich glaube, wenn er mein Filmprofessor wäre, dann hätte ich jetzt eine gute Note! (Lacht)
Aber in diesem Verhältnis standen Sie tatsächlich nie zueinander, oder?
Ich war nie an seiner Schule, aber ich bezeichne ihn trotzdem als meinen Lehrer. Ich habe bei ihm unterrichtet, dabei hat er mir eigentlich immer erklärt, wie man unterrichten muss. Dadurch hat er auch mich im Filmen unterrichtet und war von da an mein Mentor.
Ob Sie tatsächlich seine Geschichte verfilmen wollten, mussten Sie sich aber lange überlegen. Stimmt es, dass Ihre Entscheidung dafür während eines Cannes-Festivals fiel und mit reichlich Alkohol verbunden war?
Es war Rosé im Spiel, ja! (Lacht) Nicht der von Brad Pitt, auf dem bin ich in einem anderen Jahr in Cannes mal hängen geblieben, als er ihn mit zu einem Dinner zu „Once Upon A Time … In Hollywood“ mitgebracht hatte. Es war ein anderer Rosé, ich komme gerade nicht drauf, aber auch sehr gut, und ich saß nach einem Lunch zu Ehren von James Gray mit einer hartgesottenen Runde französischer Filmemacher zusammen. Ich war schon ein bisschen tipsy und habe dann irgendwann gesagt: „Hey Guys, ich hab mal eine Frage an euch, ich bin in der und der Situation, soll ich den Film machen oder nicht?“ Sie meinten, unbedingt, aber ich warf ein: „Ich habe keinen persönlichen Bezug dazu.“ Und die Franzosen sagten: „Den findest du unterwegs.“
Sie hatten recht.
Betrunkene sagen immer die Wahrheit.
“Ich habe meine Firma nicht mit dem Ziel gegründet, reich zu werden, und ich bin es bislang auch noch nicht geworden"
Um am Ende noch mal den Bogen zum Anfang unseres Interviews zu schlagen, an dem wir über „Rheingold“ gesprochen haben: Als wir uns zuletzt getroffen haben, saßen wir zu dritt zusammen, gemeinsam mit Giwar Hajabi. Wie haben Sie sich nach seinem plötzlichen Tod im Mai von ihm verabschiedet?
Am Tag, als er gestorben ist, habe ich seine Musik rauf und runter gehört. Allerdings konnte ich mich erst mal gar nicht wirklich von ihm verabschieden und auch nicht zu seiner Beerdigung gehen, weil ich zu dieser Zeit mit „Amrum“ in Cannes war, deshalb bin ich noch immer traurig. Aber ich bin auch glücklich, diesen Film gemacht zu haben, als Teil seiner Unsterblichkeit. Er ist eines seiner Denkmäler, genauso wie seine Platten. Leider hatten wir zuletzt wenig Kontakt wegen unserer vielen unterschiedlichen Projekte. Man erwartet ja auch nicht, dass Leute gleich sterben, sonst würde man wahrscheinlich öfter miteinander kommunizieren. Aber ich erinnere mich noch gut daran, wie er das letzte Mal mit ein paar Freunden bei mir zu Hause war. Wir saßen auf dem Balkon, und er hat geraucht und geredet, es ging um ein neues Filmprojekt.
Fehlt er Ihnen?
Ich vermisse ihn in bestimmten Momenten. Und gleichzeitig kenne ich ihn auf eine gewisse Weise mit seinem Tod jetzt besser, manches erschließt sich mir mehr.
Was genau meinen Sie damit?
Ich glaube, dass Giwar nicht der Geschäftsmann war, für den ihn alle hielten. Dieses Bild, das er selbst ja auch befeuert hat und das sogar das Hochfeuilleton von ihm übernommen hat, dass er ein genialer Stratege ist, der hier noch eine Firma hat und dort noch ein Imperium, das war so nicht richtig. Klar, war er ein guter Marketingstratege, er war pfiffig, aber er war vor allem Musiker. Und was ich von seiner letzten Tour gehört habe, glaube ich, dass er das am Ende auch so für sich erkannt hat. Mit den Heavytones hat er in Konzertsälen und Opernhäusern gespielt, zu denen er sonst nie Zugang hatte, das muss ihn auf eine gewisse Weise erfüllt haben. Ich wünschte, wir alle hätten den Künstler in ihm mehr beschützt und uns weniger mit dem Geschäftsmann auseinandergesetzt.
Weil sich das Lebens eines Unternehmers nicht mit dem als Künstler vereinbaren lässt?
Ich habe zwar auch eine Firma, aber nicht zehn Firmen wie er. Und ich verkaufe auch keine Würstchen in Supermärkten oder so was. Die einzige Firma, die ich habe, ist dazu da, um meine Kunst zu schützen. Sie ermöglicht mir, dass ich das machen kann, was ich mache. Ich habe meine Firma nicht mit dem Ziel gegründet, reich zu werden, und ich bin es bislang auch noch nicht geworden.
Zumindest ein bisschen reich aber schon, oder?
Verglichen mit der Armut in der Welt: ja. Ich will hier nicht über Zahlen reden, sonst gibt es Schlagzeilen (lacht). Aber viele Leute verwechseln auch Ruhm mit Reichtum. Sagen wir so: Ich habe keinen Hunger, ich habe keine Schulden. Ich bin selbst gesund und habe eine gesunde Familie. Allein deshalb bin ich wahrscheinlich der reichste Mensch der Welt.